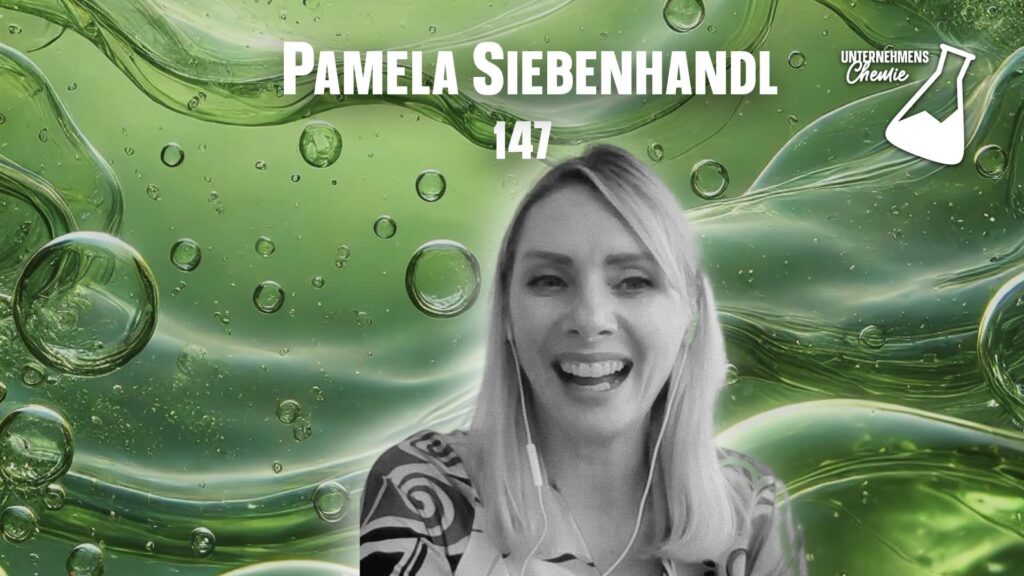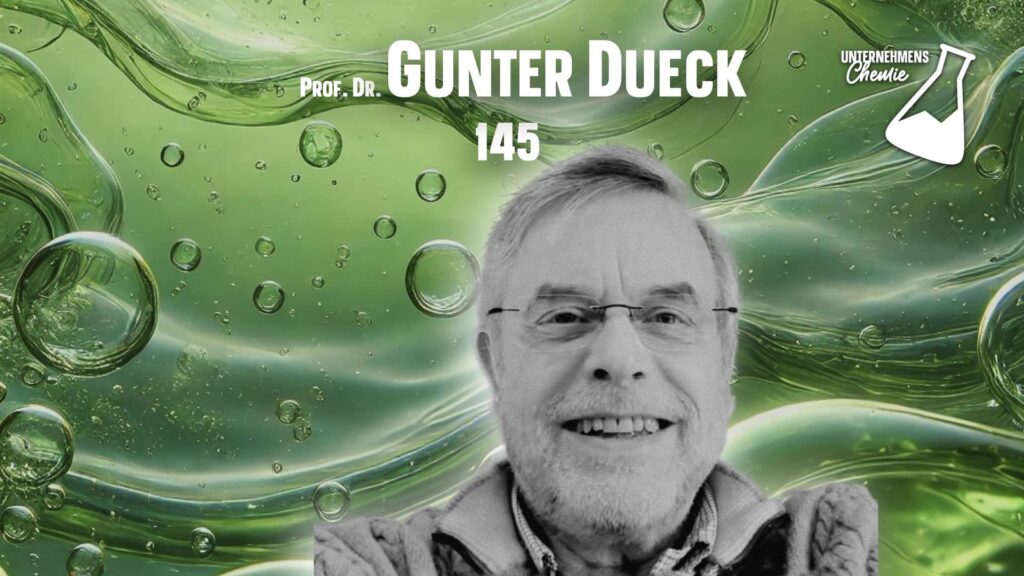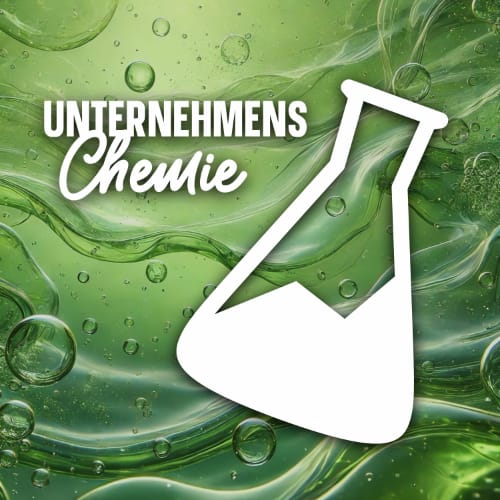Die Folge beleuchtet die Risiken des Begriffs „interner Kunde“ und erklärt, wie dadurch der Fokus vom eigentlichen Endkunden verloren gehen und Unternehmensressourcen missbraucht werden können.
In dieser Folge steht der Begriff des „internen Kunden“ im Mittelpunkt und wird kritisch hinterfragt. Der Host betont eingangs, dass viele Unternehmen dieses Schlagwort nutzen, speziell wenn zum Beispiel die IT-Abteilung von den Fachbereichen als internen Kunden spricht. Er weist darauf hin, dass diese Denkweise gefährlich sein kann, denn sie lenkt den Blick vom wahren Kunden – also dem Endkunden außerhalb des Unternehmens, der letztlich für den Umsatz sorgt – ab.
Anhand eines Beispiels aus dem eigenen Beratungsalltag illustriert der Host, wie in einer großen, vertriebsorientierten Organisation die IT nahezu ausschließlich Anforderungen aus bestimmten Vertriebsbereichen erfüllte. Bei näherer Analyse zeigte sich jedoch, dass viele dieser Anforderungen weder von tatsächlichen Endkunden kamen, noch einen Mehrwert für das Unternehmen insgesamt brachten. Stattdessen dienten sie häufig nur internen Interessen, wie etwa der schnelleren Auszahlung von Provisionen für Vertriebler – ohne dass dies direkt dem Kunden genutzt hätte.
Diese Praxis birgt aus Sicht des Hosts erhebliche Gefahren: Unternehmensressourcen werden für interne Bequemlichkeiten oder Bereichsinteressen verwendet, statt für die Weiterentwicklung und das Angebot, das echte Kundenbedürfnisse adressiert. So verlieren Abteilungen durch den intensiven Fokus auf „interne Kunden“ leicht aus dem Blick, was außerhalb des Unternehmens passiert, und ignorieren damit, wer das Unternehmen eigentlich finanziert.
Auch in anderen Funktionen wie der Personalabteilung erlebte der Host, wie das Verständnis von „Kunde“ verschwimmt. Dort werden etwa Fachbereiche und Bewerber als Kunden betrachtet, während der Beitrag zum eigentlichen Unternehmensziel – Kunden zu gewinnen und zu binden – weniger deutlich präsent ist. Dadurch entstehen komplexe Prozesse mit wenig Nutzerorientierung, was sowohl intern als auch extern Frust erzeugt und dem Unternehmensimage schaden kann.
Ein weiterer Kritikpunkt: Die Bezeichnung „interner Kunde“ kann zudem ein Hierarchieverhältnis manifestieren, das eigentlich nicht zielführend ist. Vielmehr sollten Kollegen innerhalb eines Unternehmens auf partnerschaftlicher Augenhöhe zusammenarbeiten, anstatt sich in Dienstleister-Kunden-Relationen zu verstricken. Solche Strukturen fördern Silodenken und erschweren die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die gerade heute bei sich schnell ändernden Marktbedingungen unerlässlich ist.
Der Host empfiehlt deshalb: Im eigenen Unternehmen aufmerksam darauf achten, wenn von „internen Kunden“ gesprochen wird. Dabei sollte man immer prüfen, ob tatsächlich noch das Wohl des ganzen Unternehmens und die Bedürfnisse des Endkunden im Mittelpunkt stehen oder ob einzelne Bereiche versuchen, über die interne Kunden-Lieferanten-Logik eigene Ziele durchzusetzen. Ziel sollte es immer sein, auf Augenhöhe gemeinsam das Gesamtziel im Blick zu behalten – nämlich den echten Kunden draußen am Markt zufrieden zu stellen und an das Unternehmen zu binden.
Abschließend ermutigt der Host die Zuhörer, solche internen Strukturen kritisch zu hinterfragen und stattdessen partnerschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Gerade im Zeitalter des rasanten Wandels gibt es draußen am Markt viele schnelle Wettbewerber, die bereit sind, Geschäftskonzepte und Kunden zu übernehmen. Ein interner Fokus auf Abteilungsinteressen kann so schnell zum Nachteil werden. Der wichtigste Tipp der Folge lautet deshalb: Niemals den Blick für den wahren Kunden verlieren und Silodenken überwinden.
erschienen in der Folge 57 im Unternehmenschemie-Podcast von und mit Dr. Oliver Ratajczak
1