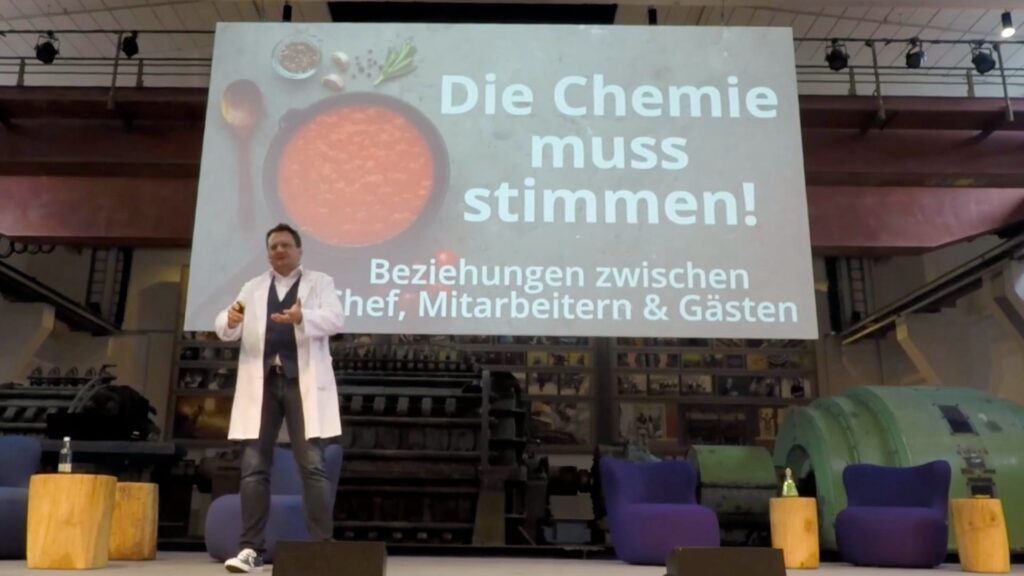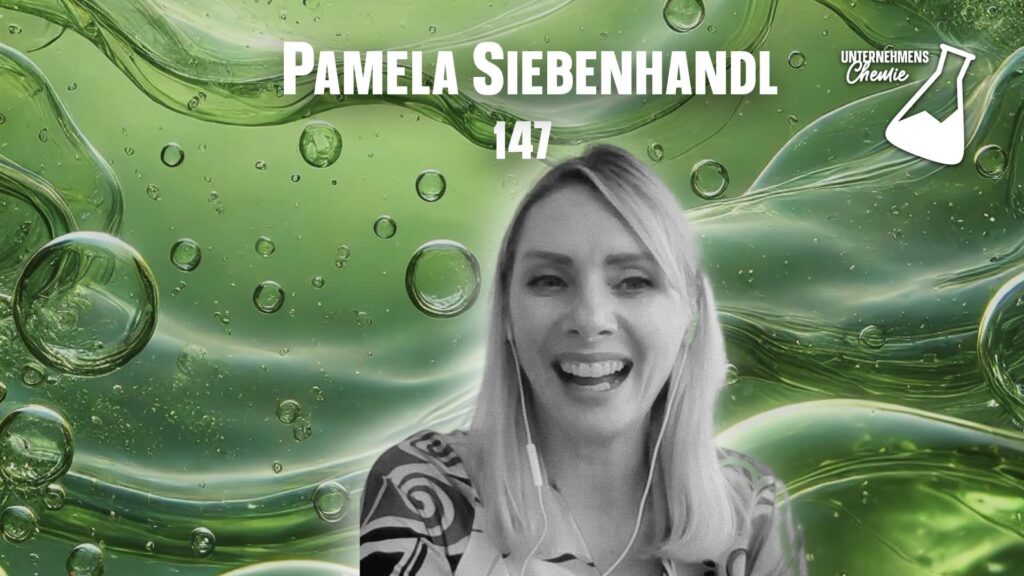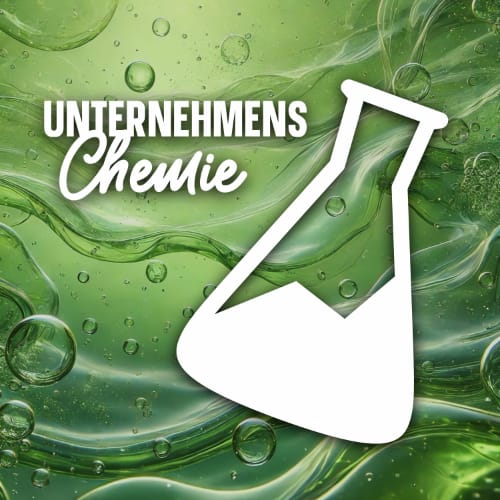Die Folge zeigt anhand eines Praxisbeispiels, warum das offene Benennen von Problemen im Projektmanagement entscheidend ist, da die Vermeidung des Wortes „Problem“ oft zu gravierenden Projektkrisen führen kann.
In dieser Folge berichtet Dr. Oliver Ratajczak aus seiner langjährigen Erfahrung als Projektleiter und Berater und rückt ein zentrales Thema in den Fokus: Wie gefährlich es ist, das Wort „Problem“ in Projekten nicht auszusprechen. Ausgehend von seiner Tätigkeit als Optimierer von interner Zusammenarbeit und Kundenprozessen erzählt er, wie er immer wieder als „Projektfeuerwehr“ gerufen wird, wenn Projekte bereits in eine kritische Schieflage geraten sind.
Ein zentrales Erlebnis ist der Einsatz bei einem großen IT-Projekt. Dort sollte in lediglich drei Monaten eine entscheidende IT-Schnittstelle realisiert werden, die für die Abrechnung und die Auslieferung digitaler Produkte notwendig war – andernfalls wären Umsatz und Kundenzufriedenheit massiv gefährdet gewesen. Beim Start des Projektes fiel ihm die Vorstellung durch den IT-Leiter auf, der ihn als „Wunderwaffe“ präsentierte, die das Projekt auf jeden Fall retten würde. Während der Vorstellungsrunde eines externen Dienstleisters geschah jedoch das Entscheidende: Der Geschäftsführer dieses Dienstleisters erklärte, dass es im Projekt keine „Probleme“, sondern nur „Herausforderungen“ geben werde – und korrigierte sich dabei sogar bewusst.
Oliver Ratajczak verdeutlicht, dass genau diese Wortwahl ein ernsthaftes Risiko birgt. Denn Projekte bestehen aus der kontinuierlichen Lösung von Problemen; die Vermeidung des Begriffs führe dazu, dass Schwierigkeiten häufig schöngefärbt oder bagatellisiert werden. Er veranschaulicht das mit dem gängigen Ampelsystem für Projektstatusberichte – mit den Farben Rot, Gelb, Grün –, das einen schnellen Überblick geben soll. In der Praxis führt der Druck, „rote Ampeln“ (also ernsthafte Probleme) zu vermeiden, jedoch oft dazu, dass Schwierigkeiten verschleiert werden. Dies zeigt sich an sogenannten „Melonenampeln“: Nach außen grün dargestellt, im Inneren aber knallrot. So werden Probleme nicht offen kommuniziert, weil Projektleiter Angst haben, in den Fokus des Managements zu geraten.
Ein weiterer Punkt ist die weit verbreitete Sorge vieler Projektleiter um ihren Job, sobald sie Probleme offen ansprechen. Dadurch entsteht eine Kultur, in der Herausforderungen schöngeredet und kritische Themen vertuscht werden – was letztlich dazu führen kann, dass Projekte aus dem Ruder laufen und Unternehmen massive Verluste entstehen, wie etwa bei Großprojekten im öffentlichen Sektor. Die Folge: Notwendige Ressourcen oder Unterstützung bleiben aus („Wenn kein Problem gemeldet wird, glauben alle, es läuft, und niemand hilft.“).
Ratajczaks deutliches Plädoyer: In Projekten muss das Wort „Problem“ offen und ehrlich verwendet werden, weil nur so gemeinsame Lösungsfindung, echte Transparenz und rechtzeitiger Handlungsbedarf möglich sind. Führungskräfte sollten ein Klima schaffen, in dem es erlaubt und sogar gewünscht ist, auf Probleme hinzuweisen. Verdrängung oder Umbenennung kritischer Themen verhindert effektive Zusammenarbeit und gefährdet Projekterfolge massiv, unabhängig von der Projektgröße.
Abschließend appelliert er, Probleme im Projekt als solche zu benennen und offen um Hilfe zu bitten, um langfristig Projekte – egal welcher Größe – solide und erfolgreich umzusetzen.
erschienen in der Folge 11 im Unternehmenschemie-Podcast von und mit Dr. Oliver Ratajczak
0