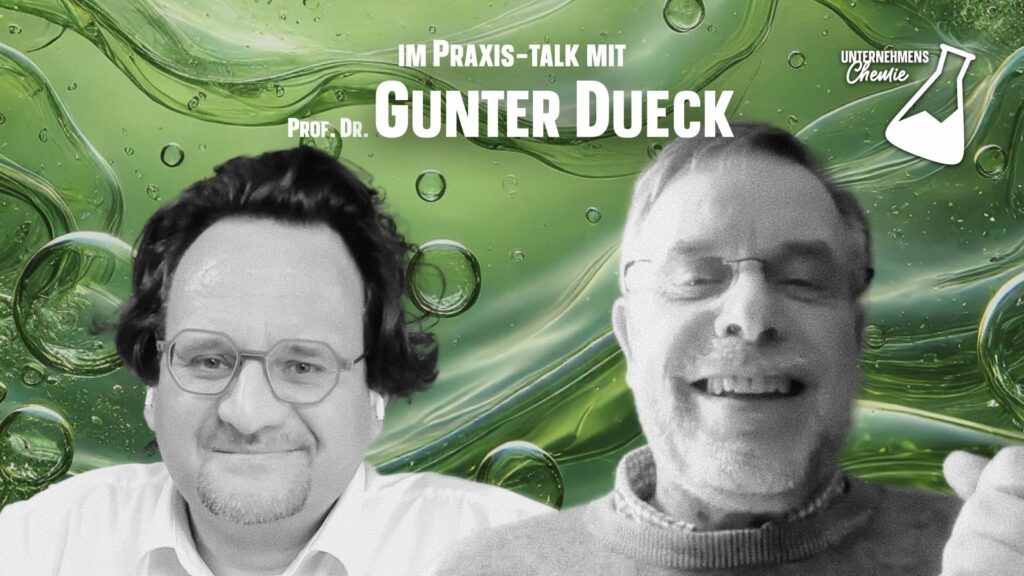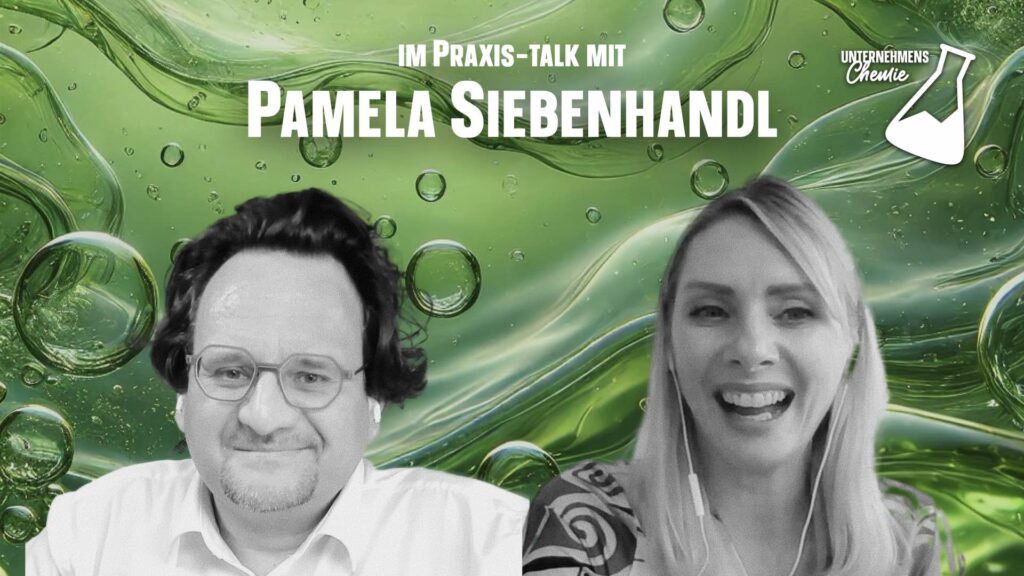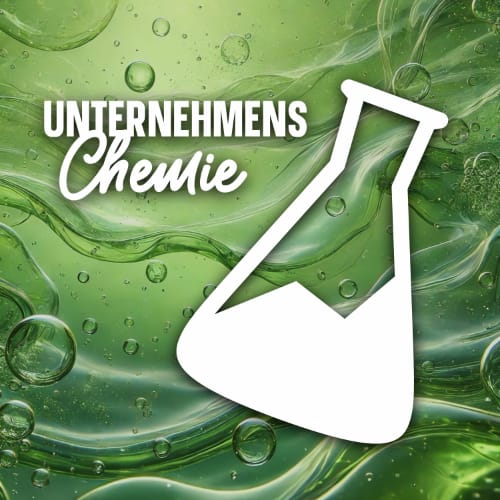In dieser Folge wird erklärt, wie der Net Promoter Score (NPS) funktioniert, welche Schwächen und Manipulationsmöglichkeiten er bietet und warum Unternehmen die Aussagekraft dieses Wertes kritisch hinterfragen sollten.
In der aktuellen Episode dreht sich alles um das Thema Net Promoter Score (NPS) und wie Unternehmen mit dieser Kennzahl umgehen – oder sie manipulieren. Zu Beginn wird die übliche Kundenzufriedenheitsbefragung als aufwendig, selten und oft wenig aussagekräftig dargestellt, da Prozesse wie Papierfragebögen, lange Abstimmungsschleifen und unklare Fragen häufig zu wenig hilfreichen Ergebnissen führen. Der Net Promoter Score dagegen erscheint auf den ersten Blick als einfache, universelle Lösung: Kunden werden gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie das Unternehmen einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen würden, und die Antwort erfolgt auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht wahrscheinlich) bis 10 (äußerst wahrscheinlich). Promotoren sind Kunden, die 9 oder 10 vergeben, Detraktoren solche mit einer Bewertung zwischen 0 und 6. Dazwischen stehen die „Passiven“ mit 7 oder 8, die in der Berechnung ausgeklammert werden. Der NPS ergibt sich aus dem Anteil der Promotoren minus dem Anteil der Detraktoren.
Der Charme des NPS liegt in seiner Einfachheit: Alle Kundenzufriedenheit wird auf eine einzige Zahl reduziert, was Führungsetagen, Controlling und Mitarbeitenden die Orientierung erleichtert. Doch genau hierin liegt auch eine große Gefahr: Die Eignung des NPS als zentrale Managementkennzahl wird kritisch beleuchtet, da so eine einfache Formel ein hochkomplexes Konstrukt wie Kundenzufriedenheit kaum abbilden kann.
Vor allem, wenn der NPS direkt an Ziele und Boni der Mitarbeitenden gekoppelt wird, besteht das Risiko der Manipulation – und zwar auf vielfältige Weise. Beispielsweise kann schon der Zeitpunkt der Befragung einen Unterschied machen: Findet sie kurz nach einem positiven Erlebnis oder nach einer Beschwerde statt? Wird der Kunde vielleicht kurz nach einer Goodwill-Aktion oder einem Geschenk befragt? Auch die Auswahl der befragten Kund:innen ist entscheidend: Werden alle kontaktiert oder nur eine bestimmte, womöglich wohlwollendere Teilgruppe? Je nachdem, wie die Stichprobe zusammengesetzt ist, lässt sich der Wert gezielt beeinflussen. Ein weiteres Problem ist, dass der NPS in die Zukunft gerichtet fragt („würden Sie weiterempfehlen?“), anstatt tatsächlich messbares Verhalten abzufragen. So kann er eher den Optimismus der Kunden als deren wirkliche Loyalität widerspiegeln.
Der Podcast regt dazu an, kritisch zu hinterfragen, ob der NPS im eigenen Unternehmen sinnvoll eingesetzt wird oder lediglich als Ausrede dient, sich nicht wirklich mit den individuellen Anliegen der Kundschaft auseinanderzusetzen. Außerdem wird angeregt, die Befragungen so zu gestalten, dass möglichst wenig Raum für bewusste oder unbewusste Beeinflussung bleibt. Als Denkanstoß dazu dient ein Überblick über typische Manipulationsmöglichkeiten und deren Auswirkungen. Abschließend wird betont, dass Kennzahlen wie der NPS niemals den direkten Kontakt zum Kunden und das echte Zuhören ersetzen können. Das Ziel sollte vielmehr eine gezielte und ehrliche Beschäftigung mit der Kundenperspektive sein, statt sich zufrieden mit guten NPS-Werten zurückzulehnen.
erschienen in der Folge 60 im Unternehmenschemie-Podcast von und mit Dr. Oliver Ratajczak
0