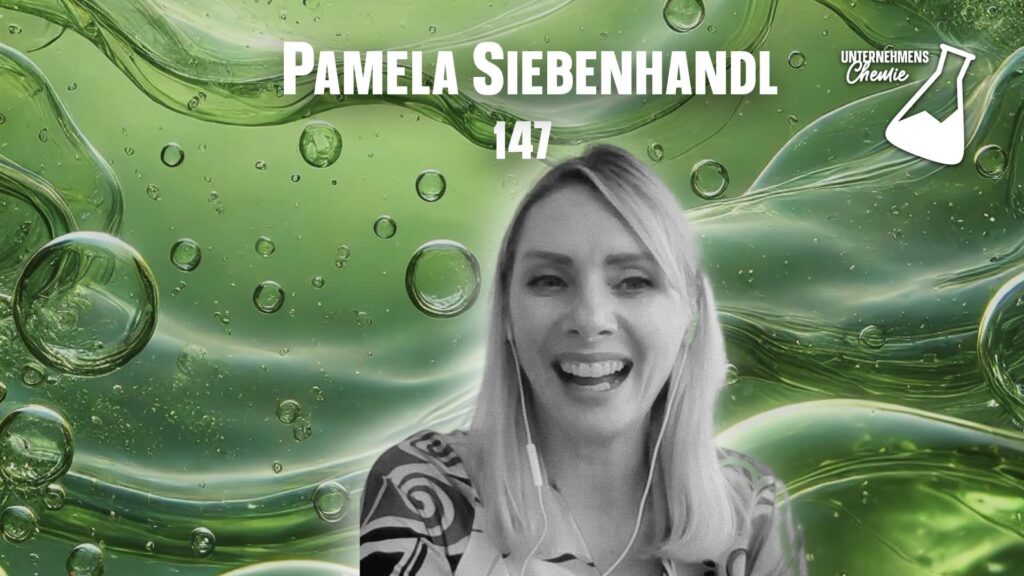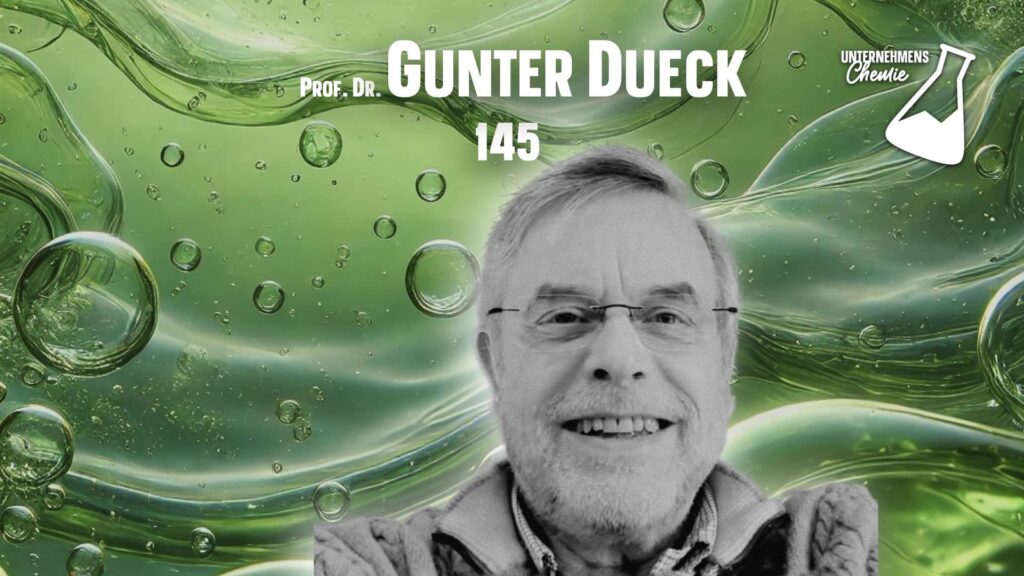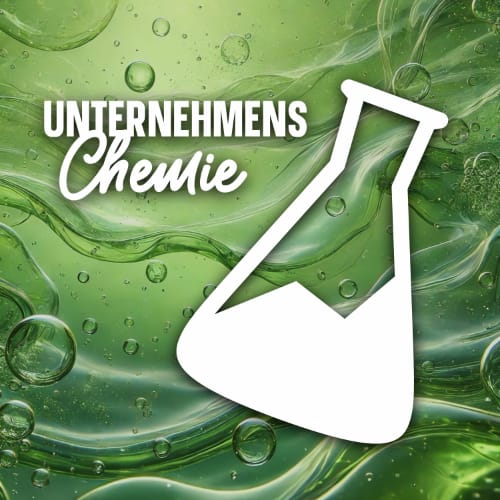Die Folge zeigt auf, warum Change-Management-Projekte häufig scheitern, welche Fehler dabei gemacht werden und welche Maßnahmen helfen, nachhaltigen Wandel und eine bessere Kommunikation im Unternehmen zu etablieren.
In dieser Episode dreht sich alles um die Erfolgsfaktoren und Stolpersteine im Change Management. Ausgehend von der Beobachtung, dass viele Unternehmen aktuell unter dem Schlagwort Digitalisierung zahlreiche Projekte ins Leben rufen, wird kritisch hinterfragt, warum speziell Change-Management-Projekte häufig ins Leere laufen. Ein zentrales Problem ist die Verlagerung der Verantwortung: In vielen Organisationen wird Change Management zu einer Aufgabe erklärt, die „der Thomas“ oder ein konkretes Team übernimmt. Das führt zu einem falschen Verständnis – Veränderung wird als abgegrenzte Aufgabe einer einzelnen Abteilung betrachtet, anstatt als ein Prozess, an dem die gesamte Organisation mitwirken muss.
Der Vergleich mit klassischen Projekten bringt einen weiteren Denkfehler ans Licht: Change-Management-Projekte werden oft mit definiertem Anfangs- und Endpunkt organisiert, so wie man es aus dem Projektmanagement kennt. Tatsächlich ist Wandel jedoch kontinuierlich und Teil des täglichen Geschäftslebens – ein Prozess ohne festes Enddatum. Wer sich hier an Projektplänen klammert, verpasst viel zu oft die Chance auf nachhaltige Entwicklung, weil nach Ablauf des Projektes das Thema als erledigt abgehakt wird, obwohl Veränderung noch gar nicht vollzogen ist oder das Umfeld bereits neue Anpassungen erfordert.
Auch die Kommunikation ist häufig ein Trugschluss: Viele Change-Projekte beschränken sich auf das Senden von Botschaften der Unternehmensleitung an die Gesamtbelegschaft, die Strategie wird „verkündet“ – Feedback oder echte Kommunikation auf Augenhöhe findet jedoch nur selten statt. Entscheidender Erfolgsfaktor ist deshalb der Aufbau funktionierender Rückkanäle: Informationen, Hinweise und Stimmungen aus allen Teilen der Organisation müssen schnell und unbürokratisch die Projekt- oder Unternehmensleitung erreichen können. Das klassische Kaskadenprinzip – erst der Teamleiter, dann der Abteilungsleiter, dann die Geschäftsführung – ist zu langsam und ineffizient für die heutige Geschwindigkeit des Wandels.
Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich gegen die direkte Kopplung von Change-Management-Projekten an große, übergeordnete Transformationsvorhaben wie neue IT-Systeme oder Digitalisierungsprogramme. Oft wird hier vermeintlich gemessen, wie viele Prozentpunkte der Firmenkultur bereits „geändert“ wurden – dabei geht es meist nur um die Abarbeitung von Aufgabenlisten. Echte Veränderung im Verhalten oder in der Zusammenarbeit lässt sich aber nicht einfach in Prozent ausdrücken.
Abschließend gibt die Folge konkrete Empfehlungen für Systeme und Maßnahmen, mit denen nachhaltiger Wandel und bessere Kommunikation in Unternehmen unterstützt werden können:
Erstens sollten moderne Social-Intranet-Systeme oder firmeninterne Social Networks etabliert werden, um schnellen Austausch und Transparenz unabhängig von Abteilungsgrenzen und Hierarchie zu ermöglichen. Die Vorteile und Kosten wurden in früheren Episoden beleuchtet.
Zweitens werden Barcamps oder interne Unkonferenzen als regelmäßiges, offenes Diskussionsforum empfohlen, bei denen die Mitarbeitenden eigenverantwortlich Themen setzen und gemeinsam Lösungen oder neue Perspektiven erarbeiten.
Drittens stellen interne Podcasts ein oft unterschätztes Mittel dar, um Galleonsfiguren im Unternehmen sichtbarer zu machen und Informationen ebenso wie Rückmeldungen niedrigschwellig über alle Ebenen zu transportieren.
Der zentrale Appell lautet: Legt den Fokus nicht auf kurzfristige Projekte mit starren Endzielen, sondern setzt auf dauerhafte, offene Kommunikationsstrukturen und eine gemeinschaftlich gelebte Veränderungskultur, damit Wandel wirklich nachhaltig zum Erfolg werden kann.
erschienen in der Folge 77 im Unternehmenschemie-Podcast von und mit Dr. Oliver Ratajczak
2